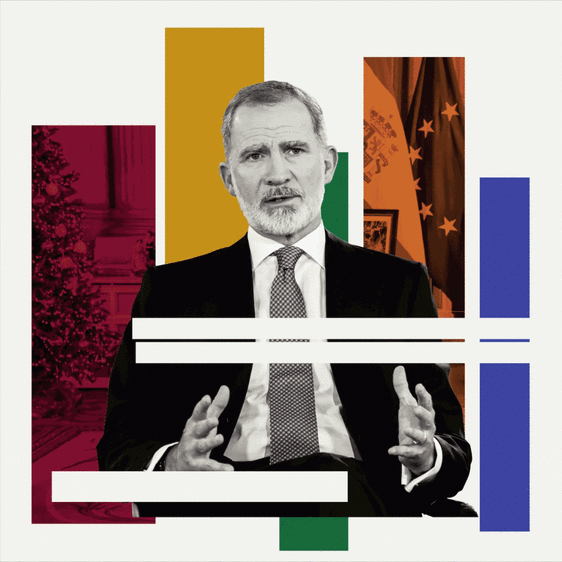Das prekäre Leben der Musiker in Spanien
Liebe zur Kunst Nur 2 Prozent haben dank der Förderung durch die Plattenfirmen Erfolg. Die anderen Künstler und Kreativen kämpfen um Anerkennung. Die Hälfte von ihnen bekommt nicht einmal den Mindestlohn
DOMÉNICO CHIAPPE
Freitag, 14. März 2025
Das Leben auf Tour beginnt um sieben Uhr morgens. Die Musiker steigen in den Kleinbus und fahren ein paar Stunden bis zum Veranstaltungsort. Ankunft im Hotel, belegte Brötchen, Soundcheck, Hamburger und Konzert. «Das ist nicht sehr gesund», sagt Juan Sebastián, ein 32-jähriger Pianist, der mehrere Jahre lang mit Künstlern auf Tournee war, die bei Sommerfestivals vor Zehntausenden von Zuschauern auftraten. «Es ist, als würde man mit seinen Freunden zelten gehen, aber man arbeitet dabei. Es sind viele Stunden des Lebens. Du wirst für den Auftritt bezahlt, arbeitest aber 14 Stunden am Tag.» Wie viel Geld ein Künstler mit nach Hause nimmt, hängt davon ab, «ob die Chefs angemessen bezahlen. Je mehr sie sagen, dass sie die Musik lieben, desto schlechter zahlen sie». Üblich sind zwischen 350 und 500 Euro pro Auftritt, abhängig von der Größe des Publikums: bei 15.000 Zuschauern eher Ersteres, bei 40.000 eher Letzteres. Auch die Größe der Band, die aus vier bis zwölf Musikern bestehen kann, spielt eine Rolle. «Vom Verlassen des Hauses bis zur Rückkehr verdient man etwa 20 Euro brutto pro Stunde», rechnet Juan Sebastián vor. «Bei einem Festival sollte man nicht weniger als 800 Euro pro Konzert bekommen.»
Live-Auftritte sind der «wichtigste wirtschaftliche Rettungsanker für Musiker», aber mehr als die Hälfte von ihnen verdient nicht den Mindestlohn. Laut der Arbeitsmarkt- und Sozialstudie über Musiker in Spanien, die von der 'Sociedad Artistas Intérpretes o Ejecutantes' (AIE) durchgeführt wurde, verdienen 16 Prozent nicht einmal 6.000 Euro im Jahr, weitere 27 Prozent unter 12.000 Euro. Jeder siebte Euro stammt aus Konzerten, der Rest aus Tantiemen und den Zahlungen von Plattenfirmen und Online-Plattformen. «Wir sind Überlebende in einem prekären Sektor», sagt Juan Sebastián. «Außerdem ist der Beruf unterbewertet und unterbezahlt.»
Juan Sebastián, der sich ausschließlich der Musik widmet, gehört zu den 70 Prozent, deren Hauptbeschäftigung die künstlerische Tätigkeit ist. Juan Sebastián hat zwei Jazz-Alben veröffentlicht ('Lluvia de mayo' 2012 und 'Tribute' 2017) und versichert, dass er dabei Verlust gemacht hat und die Tantiemen aus dem Streaming nicht ausreichen, um ein weiteres Album aufzunehmen. «Durch das Unterrichten, dem sich der Großteil der Zunft widmet, decken viele von uns diesen Teil ab. Die Plattformen zahlen sehr wenig, weil der Jazz wenig Zulauf hat. Ich rechne nicht viel nach. Aber ich weiß, dass ich mit dem Verkauf auf CD mehr Geld verdient habe. Für den 'Underground' war das einträglicher, aber die Aufmerksamkeit war geringer. Geld kommt von vielen Seiten. Ich habe immer noch keinen finanziellen Erfolg», sagt Juan Sebastián. Warum also mehrere tausend Euro in ein Album investieren? «Das Album ist notwendig, um zu zeigen, wer man ist. Nur 2 Prozent haben Kontakte zu einer großen Plattenfirma, 84 Prozent haben überhaupt keinen Vertrag.
Astrid Canales begann ihre musikalische Ausbildung im Alter von vier Jahren auf Ibiza. Mit zwölf Jahren spielte sie bereits Konzertbratsche in Orchestern und machte mit 18 Jahren ihren Abschluss an einem deutschen Konservatorium. Ihr musikalischer Weg führte sie zum Neo-Soul, einer Mischung aus Elektronik, Gospel, Jazz und Hip-Hop. «Ich habe einen Weg gewählt, der weder einfach noch schnell ist: mein eigenes Projekt mit eigenen Kompositionen, bei dem ich alles selbst produziere. Man braucht viel Geduld und Beharrlichkeit», erklärt die 28-Jährige, zu deren Werken 'Amantes' und 'Tan salvajes' gehören. «Jetzt unterrichte ich, bin Komponistin, Produzentin und Arrangeurin, andere engagieren mich für die Partituren, die sie bei Konzerten oder Aufnahmen spielen.»
Wie Astrid Canales sind nach der AIE-Studie, die auf einer Befragung von mehr als 1.600 Mitgliedern im Jahr 2023 basiert, 69 Prozent der Musiker 'Mehrfachbeschäftigte'. Die meisten von ihnen kombinieren das Musikmachen mit dem Unterrichten, sind in verwandten Berufen als Tontechniker, Manager oder Produzenten beschäftigt oder sie sind in mehreren Bands tätig, wobei sechs von zehn etwa 40 Konzerte im Jahr geben und ein Zehntel jeden dritten Tag. Außerdem gibt es in der Branche ein Lohngefälle: Frauen verdienen laut der Studie 13 Prozent weniger als Männer. «Freiberufliche Künstler sind ziemlich auf sich allein gestellt», warnt Canales. «Wenn wir nicht als Lehrer arbeiten wollen, ist unsere Situation prekär, wir hängen an einem seidenen Faden. Die Auftritte werden in der Regel auf Rechnung bezahlt, ohne Anmeldung als Angestellte, sondern als Selbstständige mit einem hohen Sozialversicherungsbeitrag.»
Trotz der negativen wirtschaftlichen Aspekte, wie z. B. der Tatsache, dass Musiker bei Erreichen des Rentenalters im Durchschnitt nur 18 Beitragsjahre haben, dass Verträge pro Auftrittstag überwiegen, dass befristete Verträge Jahr für Jahr zunehmen und dass nur zwei Prozent einen Vertrag mit einer großen Plattenfirma haben, bleiben viele dabei. «Die Freiheit ist für mich fundamental», sagt Juan Sebastián, der gerade sein drittes Album mit dem Titel 'Diez canciones' vorbereitet. «Dank der Entscheidung für die Musik habe ich Zeit für mich, für die Erziehung meiner Tochter und für das Komponieren. Ich will kein Sklave des Systems sein.»
Live-Auftritte
Einige Musiker arbeiten in Hotels oder auf Schiffen, mit einem festen Repertoire das ganze Jahr über. Andere bei verschiedensten Anlässen, teilweise ohne Proben. Ein Veranstalter schätzt, dass 90 Prozent der Künstler, selbst internationale, nicht mal einen Saal mit 800 Personen füllen und von diesen mehr als die Hälfte nicht einmal 100 Eintrittskarten zum Preis von rund 20 Euro verkauft. Die Tage außerhalb der Wochenenden sind hart, auch in den Hauptstädten.
«Jeden Abend mache ich etwas anderes», behauptet Francisco López, bekannt als Loque. Er ist 50 Jahre alt und seit mehr als drei Jahrzehnten in der Musikszene tätig. «ich habe recht spät und eher zufällig damit angefangen. Als es ernst wurde, hab ich mich dann aber reingekniet», sagt er.
In all diesen Jahren «hat sich die Nachfrage nach Live-Musik in Form, Inhalt und Quantität stark verändert. Sie hat sich von kleinen Veranstaltungen, von denen es früher viel mehr gab, zu Makro-Events entwickelt», fasst Kontrabassist Loque zusammen. «Clubs und kleine Hallen haben zu kämpfen, sie sind keine Festivals", sagt Juan Sebastián, der zum ersten Mal in einem kleinen Club in Miranda del Ebro auftrat, als er an der Musikene, der Hochschule für Musik im Baskenland, studierte. Er war 19, als er sein erstes Album in auf Hunderten von Konzerten in Sälen und auf Festivals vorstellte. «Ich kenne Spanien von Norden bis Süden», sagt der Mann, der heute auch Privatunterricht in Klavier, Harmonielehre, Improvisation und Komposition gibt. Er ist ein gefragter Pianist für andere Musiker verschiedener Genres, von Flamenco bis Pop, und erinnert sich an einen Abend im Palacio de Lira mit der Herzogin von Alba und an die Tage beim Label Blue Note: «Live-Auftritte haben etwas Aufregendes, nämlich den Kontakt mit dem Publikum. Es hält jung und bringt mich gleichzeitig dazu, vor den Menschen mein Bestes zu geben.»
Wandel
In einer guten Woche in diesem Jahr konnte Loque fünf Tage lang «alles Mögliche spielen; vor Jahren war es normal, drei Wochen hintereinander jeden Abend aufzutreten. Ich unterrichte nicht, was unüblich ist, aber ich brauche wenig. Kein Auto, keine Hypothek. Aber es wird immer schwieriger, davon zu leben.» Bei Jam-Sessions gibt es mal weniger als 100, mal 300 Euro. In einer Woche Anfang November verdiente er 600 Euro brutto und fuhr mit seinem Instrument in der U-Bahn oder ging zu Fuß. Nur am letzten Abend war er erschöpft und nahm ein E-Auto per Carsharing.
Zu den Veränderungen gehört auch die Digitalisierung. Hat man früher jemanden gefragt, was er gerade hört, antwortete er mit einem Künstler- oder Bandnamen. Heute wird die Online-Plattform genannt. «Um hervorzustechen, ist ein Künstler sehr stark von den sozialen Medien abhängig», sagt Astrid Canales, deren letztes Album, das sie während ihrer Schwangerschaft aufgenommen hat, den Titel 'Abrazarte' trägt. Sie hat es mit Juan Sebastián aufgenommen. Temporäre gemeinsame Projekte sind normal in der Branche. Und Präsenz in den sozialen Medien ist grundlegend: «Wenn ich etwas poste, bekomme ich Unterrichts-Aufträge. Meine Jobs habe ich dank Instagram. Das Internet ist ein großer Marktplatz, der die Konkurrenz zwischen den Künstlern forciert. Es gibt Leute, die nicht sehr gut spielen oder singen können, manchmal braucht man das auch gar nicht. Aber wenn man Musiker ist, will man Musik machen und nicht digitales Marketing», resümiert Canales.
-U2201653514437wnD-U70832051650dKK-562x562@Diario%20Sur.jpeg)