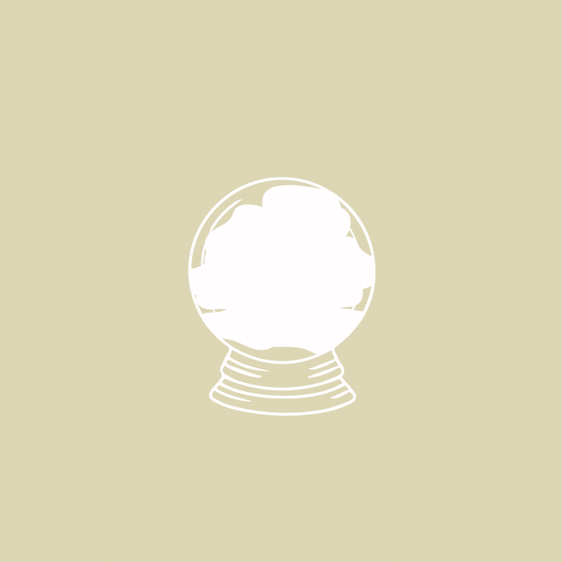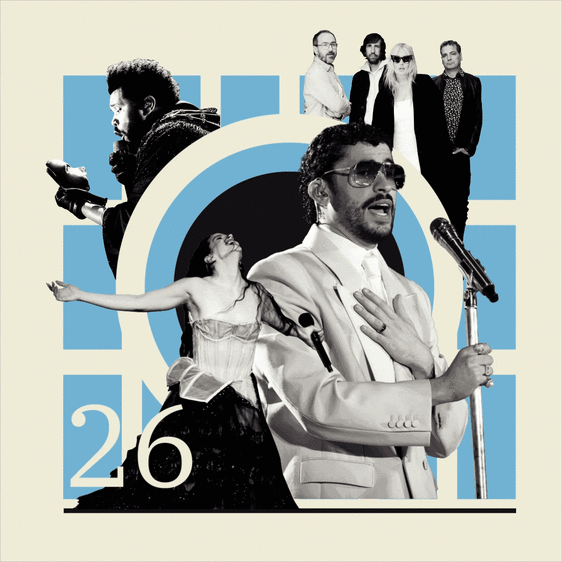Wunderbarer Wald, der die Hilfe des Menschen brauchte
Die Portugiesische Eiche gehört im Nationalpark Sierra de las NIeves zur prägenden Vegetation. Mit ihrer Anpflanzung war im Rahmen eines Hochwasserschutzplans 1991 begonnen worden. Heute dienen rund 25.000 Exemplare gemeinsam mit 230 Schutzwällen als Bollwerk für die Küste Málagas
PILAR R. QUIRÓS
Donnerstag, 2. Januar 2025
Wer noch nie im Nationalpark Sierra de las Nieves war und sich beispielsweise von der Spanischen Tanne, Pinsapo genannt, begeistern ließ, sollte einen Besuch dort unbedingt ins Auge fassen. Abies pinsapo, ein bis zu 30 Meter hoher Nadelbaum, wurde über Jahrzehnte hinweg unkontrolliert geschlagen, um sein gutes Holz für den Bau von Dächern und Hausstrukturen zu verwenden, um Öfen zu befeuern oder um als Schiffsmast oder Eisenbahnschwelle Verwendung zu finden. Und natürlich musste die Spanische Tanne auch als imposanter Weihnachtsbaum herhalten. Der Baum konnte gerade noch vor dem Aussterben bewahrt werden, steht heute unter Schutz und ist im Nationalpark Sierra de las Nieves Teil eines artenreichen Waldes. Noch schlechter erging es einem Wegbegleiter, der Portugiesischen Eiche, Quejigo genannt, die in den 1990er Jahren kurz vor dem Aussterben stand. Damals gab es gerade noch 4.000 Exemplare in der Region.
Dann aber kam ein Aufforstungsplan im Kampf gegen Erosion und Versteppung, der nun, über 30 Jahre später, endlich abgeschlossen werden konnte: die Pflanzung von 16.000 Portugiesischen Eichen und der Bau von 230 Schutzwällen. Dank der natürlichen Regenerierung gibt es heute im Nationalpark rund 25.000 dieser eindrücklichen knorrigen Eichen, die im Verbund mit der inzwischen wieder stattlichen Zahl von Pinsapos helfen, die Landschaft vor Erosion und die Küste Málagas vor Überschwemmungen zu schützen. Je mehr Erosion, umso unkontrollierter könnten im Fall von großen Niederschlägen die Abflüsse von Río Verde, Turón, Genal oder Río Grande sein.
Heute erstreckt sich in der Sierra de las Nieves ein wunderbarer mediterraner Hochgebirgswald und der Bestand an Portugiesischen Eichen bei Tolox durchzieht die gesamte Froncaire-Schlucht. Wäre hier nur die Natur am Werk gewesen, wäre die Landschaft ein kleines Wunder. Doch in diesem Fall ist die Eichenpracht auch Menschenhand zu verdanken.
Ein Blick zurück: Im Jahr 1989 führten enorme Niederschläge rund um die Gipfel der Sierra de las Nieves zu starker Erosion und Versteppung. Hinzu kamen eine seinerzeit intensive Beweidung und die unbändige Fresslust der Bergziegenkolonien, die sich am liebsten über junge Triebe und Setzlinge hermachten. Eine Art Molotow-Cocktail für die Natur. In Folge der sintflutartigen Regenfälle hatte die Berglandschaft am Ende sechs Zentimeter Boden eingebüßt. Daran erinnert sich auch Miguel Ángel Catalina, der damalige Direktor des Naturparks und heute im Ruhestand, noch mit Schrecken. Heute zieht es ihn mit dem aktuellen Nationalparkdirektor, Rafael Haro, und dem Leiter der Forstbehörde der andalusischen Landesregierung, Pepe Quintanilla, in die Sierra de las Nieves, um die Entwicklung zu bewerten. Damals sei klar gewesen: Es musste etwas geschehen. Zwei Jahre später wurde 1991 der Plan zum Kampf gegen Erosion und Versteppung vom spanischen Agrarministerium ins Leben gerufen: Jetzt, 33 Jahre später und inzwischen auch unter Mitwirken der andalusischen Landesregierung, geht das Projekt seinem Ende entgegen.
Sogenannte hydrologische Waldkorrekturen sind erforderlich, um sowohl die Bevölkerung als auch die mediterranen Wälder selbst zu schützen, die unter den starken Erosionsprozessen im Mittelmeerraum leiden. Es sind karge Berglandschaften, die nichts mit den atlantischen oder kontinentalen tiefgrünen Bergregionen gemein haben. In den Sierras entlang des Mittelmeers muss jeder Zentimeter Grün hart erkämpft werden. Um die Sierra de las Nieves kennenzulernen und mehr über Erosion und Folgen von regenreichen Unwettern zu erfahren, lohnt sich der Aufstieg zum Puerto Pilones, den die drei Umweltexperten Catalina, Haro und Quintanilla heute in Angriff nehmen. Die rund acht Kilometer lange Wanderung lohnt sich: Auf über 1.700 Höhenmetern gibt der Berg den Blick auf die Sierras der Provinz und die Küste frei.
Im Kampf gegen die Bodenerosion setzten sich die verantwortlichen Forstingenieure in der Sierra de las Nieves von Beginn an dafür ein, die Schäfer der Region mit einzubinden. Um die frisch gepflanzten Portugiesischen Eichen vor Schafen und Ziegen zu schützen, wurden die Setzlinge zunächst in 25 Quadratmeter große, umzäunte Areale gepflanzt, wobei je drei Quejigos und/oder eine Spanische Tanne, ein Ahorn oder eine Eberesche gesetzt wurden. Sowohl der ehemalige Naturparkdirektor als auch sein heutiger Nachfolger sind sich einig, eine Aufforstung mit nur einer Baumart habe sich damals wie heute schlicht verboten. Mischwälder seien wesentlich resistenter, sowohl gegenüber Bränden als auch Plagen und extremen Wetterphänomenen.
Dass jede Pflanze ihre Eigenarten hat, davon wissen auch die beiden Schäfer José Sánchez (85) und Juan Vera Leiva (67) viel zu erzählen. Sie treffen sich mit Catalina, Haro und Quintanilla auf ihrem Weg durch die Sierra. Leiva erinnert sich noch gut an seine anfängliche Ablehnung, als er hörte, dass große Flächen für seine Schafe gesperrt werden sollten. Im Gegenzug sollten sie die Weideflächen zwischen den Aufforstungsparzellen nutzen können. Die notwendige Überzeugungsarbeit leisteten damals die Forstbeamten, die für gegenseitigen Respekt warben und den Schäfern klar machten, dass Mensch und Wald koexistieren können und auch müssen. Dass sich die beiden Hirten und die Forstexperten noch heute austauschen, zeigt: Die Überzeugungsarbeit hat funktioniert.
Auf ihrem Spaziergang durch die Landschaft kommen sie an Igelginster vorbei, einem kleinwüchsigen Strauch mit dem Aussehen eines grünen Wildschweins, der nur in höheren Gebirgslagen wächst und dort gemeinsam mit Kriechwacholder dem Boden Halt gibt. Wo die Portugiesischen Eichen, Pinsapos, Eiben und Ahorne noch nicht groß und kräftig genug sind, sind sie von Pflanzenschutzgittern umgeben. Prächtige Exemplare hingegen haben den Schutz vor ihren Fressfeinden nicht mehr nötig. Unweit stehen auch die ersten Gabionen, von Catalina selbst entworfene Mauersteinkörbe, die das Terrain befestigen und ein Abrutschen verhindern. Auch in den Gipfelregionen sind Sturzbäche und das Material, das sie mit sich reißen, enorm gefährlich und zerstörerisch. Die Mauersteinkörbe halten nicht nur ungebetene Vierbeiner fern, sie helfen den Bäumen auch, indem sie mehr Wasserreserven speichern.
Nach über drei Jahrzehnten fehlen nur noch wenige Handgriffe, bis der Plan zum Kampf gegen Erosion und Versteppung abgeschlossen ist. Noch gilt es etwa, Bäume, die bereits eine stattliche Größe erreicht haben, von ihren Schutzgittern zu befreien. Heute ist die Projektleitung in Händen von Forstingenieurin Marta Ríos und Koordinator Cristóbal Becerra. Mit vom Team ist außerdem die Beraterin des Nationalparks und gleichsam Forstingenieurin, Natalia Ruiz. Neben der Pflanzenkontrolle obliegt es ihnen auch, die Wanderwege anzupassen oder Gebiete roden zu lassen, um Weidelandschaften zu erhalten.
Bevor der Kontrollausflug in die Sierra de las Nieves für die Forstexperten zu Ende geht, gibt es für Pepe Quintanilla noch einen sehr emotionalen Moment. Er war es, der vor 38 Jahren die damals wenigen, noch erhaltenen Pinsapos behütete, jetzt geht er in Rente. Als es auf dem Rückweg an der Froncaire-Schlucht mit ihrer heute überbordenden Vegetation vorbeigeht, sprechen ihm alle noch einmal ihre Bewunderung aus. Keiner zweifelt daran: Ohne ihn und ohne Rafael Haro hätte es die Sierra de las Nieves sehr schwer gehabt und vielleicht würde es heute dort keinen Nationalpark geben.