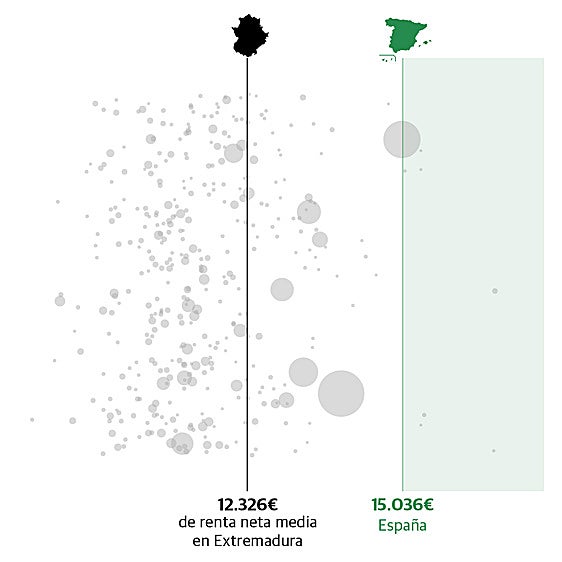Hunde als Beitragszahler
Steuern auf Haustiere. Die Debatte über die Einführung einer jährlichen Abgabe für Heimtierhalter wird neu eröffnet. 2023 hat Deutschland 421 Millionen eingenommen
IZASKUN ERRAZTI
Donnerstag, 9. Januar 2025
Ist es Luxus, einen Hund zu halten? Rechnen wir einfach mal nach: Zum Mikrochip, der in der Regel zwischen 40 und 50 Euro kostet, kommen noch die Kosten für Impfungen, Tierarzt, Futter, Hundesalon, warme Kleidung, Leckerlis, Spielzeug... Mancher mag diese Frage bejahen, vor allem, wenn er in einem jener europäischen Länder wohnt, die zusätzlich eine Steuer auf Tierbesitz erheben. Dies ist in Deutschland der Fall, wo die öffentlichen Kassen im vergangenen Jahr damit 421 Millionen Euro einnahmen, mit denen die Regierung das Haushaltsdefizit abbauen möchte.
Die im 19. Jahrhundert eingeführte Steuer wurde von den deutschen Behörden ursprünglich als Vermögenssteuer betrachtet, da sie den Besitz von Hunden zum Vergnügen als Luxus betrachteten, ebenso wie den Besitz von Schmuck und die Beschäftigung von Dienstboten.... Sie wurde im Laufe der Jahre geändert, ist aber bis heute in Kraft geblieben, wobei die Höhe der Steuer von den einzelnen Gemeinden festgelegt wird. In Frankfurt werden beispielsweise 102 Euro pro Tier erhoben, in Berlin sind es 120 Euro pro Jahr für den ersten und 180 Euro für jeden weiteren Hund. Für Besitzer von als gefährlich eingestuften Hunderassen ist es noch teurer: In einigen Städten, wie z. B. in Nürnberg, kann die Steuer bis zu 1.000 Euro betragen.
Deutschland ist kein Einzelfall. In der Schweiz hat jeder Kanton seine eigene Steuer, die je nach Gewicht und Größe des Tieres zwischen 106 und 213 Euro pro Jahr liegen kann; in den Niederlanden zahlen Bewohner von Rotterdam 120 Euro, die in Grenzgebieten jedoch nur 75 Euro pro Jahr und Tier.
Aus der Zeit Napoleons III.
In Frankreich wurde die Debatte über die Erhebung einer Jahresgebühr für Hundebesitzer wieder aufgenommen, da die Regierung nach neuen Wegen für Einsparungen und einen ausgeglichenen Haushalt sucht. Der Erfolg auf der anderen Seite des Rheins könnte die französische Regierung ermutigen, eine Steuer wieder einzuführen, die unter Napoleon III. eingeführt wurde - damals zwischen einem und zwei Francs -, um die Zahl der streunenden Hunde zu begrenzen und die Tollwut zu bekämpfen, und die 1971 vom damaligen Wirtschafts- und Finanzminister Valéry Giscard d'Estaing abgeschafft wurde, als die Einnahmen umgerechnet rund 711.000 Euro betrugen.
In unserem Nachbarland hielten im vergangenen Jahr 32 Prozent der Haushalte einen Hund, mehr als 7,6 Millionen Hunde waren laut Statista, dem Statistikportal für Marktdaten in Europa, registriert. Eine Zahl, die der öffentlichen Hand – bei einer angenommenen durchschnittlichen Steuer von 100 Euro pro Jahr – erhebliche Einnahmen bescheren, aber auch für Aufregung und Kontroversen sorgen könnte.
So war es in Zamora, der ersten spanischen Gemeinde, die Hundesteuer erhoben hat: 2019 wurde sie auf neun Euro festgesetzt. «Es war ein politisches Thema – Izquierda Unida war und ist immer noch an der Regierung. Wir waren auf allen Fernsehkanälen zu sehen», erinnert sich Diego Bernardo, derzeitiger Stadtrat für Wirtschaft und Finanzen, der ins Rathaus kam, als die Maßnahme, die, wie er sagt, nicht dazu gedacht war, Geld einzunehmen, bereits beschlossen war. «Damals war die Erfassung völlig außer Kontrolle geraten. In einer Stadt mit 60.000 Einwohnern waren fast 10.000 Hunde registriert, einige 30 oder 40 Jahre alt, die nie abgemeldet wurden», erklärt er.
Ziel der Gemeinde war es, die Zahlen zu korrigieren und mit dem eingenommenen Geld den Service für die Hundehalter zu verbessern: «Zurverfügungstellung von Kotbeuteln, Desinfektion der 'pipicanes' (Hundeklos), Instandhaltung der Zäune der Parks...». Als vier Jahre später das Ziel als erreicht angesehen wurde, setzte der Rat die Erhebung der Steuer aus. «Man hatte bereits 5.760 Hunde gezählt, und außerdem ging die Rechnung nicht auf. Mit dem Papierkram, den Benachrichtigungen, den Personalkosten... war die Steuer defizitär», räumt der Stadtrat ein.
Zamora als Vorbild
Benavente, Salamanca, Avilés, Gijón... Dies sind einige der Orte, die nach Zamora die Einführung einer Hundesteuer in Erwägung gezogen haben. Auch in Madrid, wo es in 10 von 21 Bezirken mehr Hunde als Kinder zwischen 0 und 9 Jahren gibt, wurde der Vorschlag den Bürgern zur Diskussion vorgelegt.
Guillermo Fouce, Doktor der Psychologie an der Universidad Complutense de Madrid, würde eine Steuer begrüßen, um die Kosten zu decken, die den Kommunen durch den Unterhalt von Parks für Tiere und die Beseitigung von Abfällen entstehen. «Ich denke, dass dies auch dazu beitragen würde, die Besitzer in die Mitverantwortung zu nehmen», so der Experte, der sich sogar ein Bonussystem oder eine einkommensabhängige Steuer vorstellen könnte.
Die Tierschutzpartei Pacma sieht bei dem Konzept, die Einnahmen aus einer erschwinglichen Steuer in eine spürbare Verbesserung der Infrastruktur zu investieren, trotz allem Licht und Schatten. «Das ist etwas, wofür in Wirklichkeit die Verwaltungen zuständig sein sollten und nicht die Tierhalter, die bereits 21 Prozent Mehrwertsteuer beim Tierarzt zahlen», sagt ihre nationale Sprecherin Yolanda Morales.
Cristina Cuenca, Professorin für Sozialpsychologie an der Universität Complutense in Madrid, hat eine eindeutige Meinung: «Ein klares Ja zu dieser Steuer. Ich finde sie phänomenal», betont sie. Der Grund für dieses kategorische Ja liegt in ihrer langjährigen Erfahrung als Beraterin in verschiedenen spanischen Stadtverwaltungen. «Ich habe an vielen Haushaltsplänen mitgearbeitet, und zu den häufigsten Fragen gehörte alles, was mit Hunden zu tun hatte. Die Verschmutzung der Straßen, die Belästigung...», sagt sie.
Cuesta argumentiert, dass das auf diese Weise eingenommene Geld den Tieren zugute kommen sollte – «auch wenn es keine Hunde sind» – und schätzt diese Maßnahme, die in mehreren europäischen Ländern angewandt wird, weil sie ihrer Meinung nach «ein verantwortungsvolleres Verhalten» der Hundebesitzer fördert, denn «Hunde sind keine Modeerscheinung, sie sind nicht nur ein Spielzeug. Mit ihnen hat man Rechte und Pflichten», betont sie.
2023 wurden in Spanien 9,3 Millionen Hunde gezählt, eine Zahl, die nach Ansicht der Pychologin noch steigen wird, «weil es immer mehr alleinstehende Menschen geben wird. Wir können die gesellschaftlichen Tendenzen nicht ignorieren.»