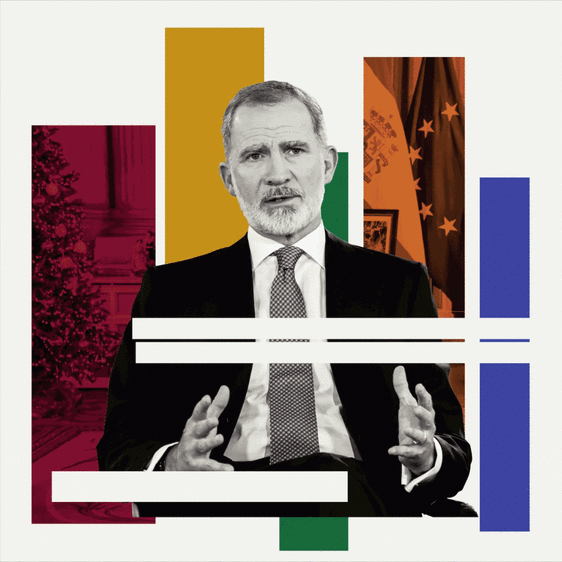La Mancha will nicht nach Gülle stinken
Protestierende Dörfer. Die einzige autonome Region, die Makrofarmen einen Riegel vorgeschoben hat, hebt ihr Veto gegen 61 Projekte auf und sorgt für Unmut in der Bevölkerung
Donnerstag, 6. Februar 2025
2023 wurden in Spanien 53 Millionen Schweine geschlachtet. Das ist mehr, als das Land Einwohner hat. 4,8 Millionen Tonnen Fleisch wurden auf den Markt gebracht, nicht nur den spanischen. Mehr als die Hälfte davon – 2,7 Millionen Tonnen – wurde exportiert. Fast zu gleichen Teilen in die Europäische Union, insbesondere nach Frankreich, und in Nicht-EU-Länder, wobei China als Hauptabnehmer von spanischem Schweinefleisch die Nase vorn hat. In Spanien gibt es rund 82.000 Schweinefarmen, das Land steht damit weltweit an dritter Stelle, wie das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung in einem Bericht vom Juli 2024 veröffentlicht hat.
Dabei handelt es sich zumeist nicht um kleine Familienbetriebe, sondern zu 93 Prozent um Betriebe mit Massentierhaltung – aus Rentabilitätsgründen, wie aus der Branche verlautet. 6.500 Betriebe unterliegen einer besonderen Überwachung ihrer Schadstoffemissionen – hauptsächlich Methan und CO2 – durch das Ministerium für den ökologischen Wandel (Miteco), weil sie mehr als 2.000 Mastschweine oder 750 Zuchtsauen in ihren Ställen halten.
-
Biomethananlagen waren Ende 2024 in Spanien in Betrieb Mehrere hundert sind in Planung. Die Einführung kommt laut Branche nur langsam voran, da der Biogas-Plan von der Regierung erst im Jahr 2022 entworfen wurde. In diesen Anlagen werden organische Abfälle in Brennstoff umgewandelt. Durch Gärvorgänge entsteht Biogas – eine nicht-fossile Energiequelle für Industrie und Verkehr – das zu Biomethan weiterverarbeitet in das Erdgasnetz eingespeist werden kann. Die festen Reste werden nach der Behandlung als Düngemittel verwendet.
-
8.520 Gigawattstunden pro Jahr würden Biogasanlagen bei Vergärung der gesamten Gülle erzeugen.
-
80% weniger Treibhausgasemissionen werden durch den Einsatz von Biogas im Vergleich zu fossilen Brennstoffen erreicht.
Was sind die Folgen? Neben einem bedeutenden Geschäftsbereich – mit einem Umsatz von 38 Milliarden Euro und mehr als 400.000 direkten und indirekten Arbeitsplätzen – eine riesige Menge an Abfall.
EIN FESTGEFAHRENER KONFLIKTNGO STOP GANADERÍA INDUSTRIAL«Die Biogasanlagen ziehen Großbetriebe an. 1,9 Millionen Schweine sind genug»SCHWEINEFLEISCHPRODUZENTEN«Viele Projekte sind nicht mehr konkurrenzfähig. Die Verordnung ist unverhältnismäßig»REGIONALREGIERUNG«Die Verordnung ebnet den Weg für eine Aufwertung von Gülle und adäquate Bewirtschaftung»
Nach Schätzungen von Adap, dem Unternehmerverband zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung durch Gülle, müssen jährlich 70 Millionen Tonnen Exkremente und Urin ordnungsgemäß entsorgt werden. Und das nicht nur, weil sie stinken, sondern weil sie im Übermaß die Umwelt verschmutzen. Sie sind mit Nitraten belastet, die zwar düngen, aber bei Missbrauch die Grundwasserleiter verseuchen. Wie Miguel Ángel Higuera, Präsident des Nationalen Verbandes der Schweinezüchter (Anprogapor), anmerkt, gibt es sogar eine Vorschrift für die Verwendung als Düngemittel: «Jetzt werden sie in den Boden ‚injiziert' und nicht mehr mit Sprühgeräten ausgebracht, um den Geruch zu reduzieren», sagt er.
Die beiden Seiten der Medaille
Nur 170 Kilo Stickstoff pro Hektar Land sind erlaubt. Ein Bericht von Adap rechnet vor: «Ein mittelgroßer Betrieb mit 100.000 Tonnen Gülle pro Jahr benötigt 1.800 Hektar Land, das entspricht 3.600 Fußballfeldern, um diese Abfälle korrekt und ohne Risiko auszubringen.»
Die Viehzucht ist nicht die einzige Quelle; das stimmt. Auch der Ackerbau ist mitverantwortlich für die Ausbringung von Nitraten zur Düngung. Aber irgendwas läuft falsch.
Spanien hat nachweislich ein Problem mit der Nitratverschmutzung seines Wassers. Im März 2024 verhängte der Europäische Gerichtshof deshalb eine Geldstrafe gegen Spanien. Nach Angaben des Umweltministeriums sind Aragón, Katalonien sowie Castilla y Leon am stärksten von dieser Art der Wasserverschmutzung betroffen. Dies sind gleichzeitig die Regionen mit der ausgeprägtesten Massentierhaltung.
All diese Zahlen zeigen die Bedeutung, aber auch die ökologische Verantwortung einer Branche, die sich keineswegs zurückzieht, sondern wachsen will. Und welche Region ist am ehesten bereit, sie aufzunehmen? Castilla-La Mancha.
Widerstand in der Mancha
Bis zum Januar 2025 war dies die einzige autonome Region, die der Ausweitung der Massentierhaltung seit 2022 einen Riegel vorgeschoben hat. «Der enorme Druck der Einwohner», sagt Antonio Jorge, einer der Sprecher der Plattform 'Stop Ganadería Industrial', die sich aus rund hundert Verbänden zusammensetzt, habe zu einem Moratorium geführt, das neue Betriebe oder die Erweiterung bestehender Betriebe verbot. «Anhand der großen Protestbewegung sahen sie, dass das Thema außer Kontrolle geriet», fügt er hinzu.
Die Menschen forderten – und fordern immer noch – ein endgültiges Veto. Denn, so sagen sie, «1,9 Millionen Schweine sind schon genug für die Region». Man will nicht das Niveau von Aragón oder Katalonien erreichen. Aber die Regionalregierung glaubt, dass es Raum für Wachstum gibt.
So endete am Freitag das Moratorium, das 61 Projekte lahmgelegt hatte, wie Quellen aus der Generaldirektion für Umweltqualität der Regionalregierung von Castilla-La Mancha gegenüber dieser Zeitung bestätigten. «Wir kontaktieren sie, um sie über die neue Situation zu informieren und sie entscheiden zu lassen, ob sie fortfahren wollen», heißt es dort.
Die neue Verordnung verpflichtet Betriebe mit mehr als 2.500 Tieren, ihre Gülle in Biogasanlagen zu behandeln, und verbietet die direkte Ausbringung. «Kleinere Betriebe brauchen keine Behandlung», sagen sie. Sie können die Gülle innerhalb der gesetzlichen Grenzen zumindest in den nächsten zehn Jahren noch als Düngemittel nutzen.
Diese von der Regierung als Pionierarbeit in Spanien zur «Aufwertung von Gülle als Düngemittel» und zur «Gewährleistung einer adäquaten Bewirtschaftung« gepriesene Neuerung, die sich derzeit in der Entwicklungsphase befindet, hat der Empörung eine neue Dimension verliehen. Jeden Tag gibt es einen Aufschrei aus irgendeinem Dorf, das gegen die Eröffnung einer Biogasanlage demonstriert – in La Mancha und darüber hinaus.
Nach Ansicht der zitierten Plattform gehen industrielle Tierhaltung und Biogasanlagen mit der neuen Verordnung Hand in Hand. Sie befürchten sogar einen Dominoeffekt. Higuera wiederum betont, das Gegenteil sei der Fall: «Viele Viehzüchter haben ihre Projekte gestoppt, weil die Verordnung, die absolut unverhältnismäßig und inkohärent ist, sie weniger wettbewerbsfähig macht.»
Biogas wird durch die Vergärung organischer Abfälle gewonnen. Für die Viehzüchter ist das der Schlüssel: «Was die Region braucht, sind Anlagen, die Abfälle richtig aufbereiten. Aber es ist schön zu sagen, dass es darum geht, den Geruch von Gülle loszuwerden», meint Higueras.
Niemand ist mit dem neuen Rechtsrahmen zufrieden. Der Verband der Biogasunternehmen (Aebig) hat sich auf Nachfrage in keiner Weise geäußert. Sein Präsident verteidigte in einem kürzlich erschienenen Artikel, dass der Sektor der Schlüssel zur Dekarbonisierung und ein Verbündeter des Agrar- und Viehsektors sei, da er Abfälle in weniger umweltschädliche Brennstoffe umwandele.
Doch in den Dörfern herrscht, wie schon bei den Windparks und den Photovoltaikanlagen, Ablehnung. Die Regionalregierung von Castilla La Mancha führt dies auf «Unwissenheit» zurück, da die neuen Anlagen über bessere Technologien verfügten und sie diese «überwachen» würden.
Für die Plattform verbirgt sich hinter diesem grünen Diskurs «eine große Investitionsgier», die Menschen zweifeln an den Versprechungen. «Es ist schwierig, die Gerüche von 210.000 Tonnen Müll zu kontrollieren, die in Lastwagen hin- und hergefahren werden», sagt deren Sprecher. Die Einwohner befürchten eine wesentliche Verschlechterung der Luftqualität.
Der Erlass legt Mindestabstände zu Siedlungen fest. «Aber», so der Sprecher, «was ist mit Orten mit 300 Einwohnern? Und mit denen, die ein abgelegenes Haus auf dem Land haben? Sie können sich nicht mobilisieren. Sie bekommen die Anlage und die Makrofarm vor die Nase gesetzt. Halten Sie uns nicht für dumm. Wir müssen nicht für ihre Gewinne bezahlen.»
-U2201653514437wnD-U70832051650dKK-562x562@Diario%20Sur.jpeg)